Empathie wird meist im privaten Kontext gesehen und diskutiert. Aber sie ist eine individualpsychologische Kompetenz, die für eine gelingende Demokratie über Unterschiede hinweg zentral ist.
Demokratie als (empathische) Lebenspraxis
Man kann Demokratie für eine Regierungsform halten, was natürlich richtig ist, aber recht verkürzt. Oder für ein hehres Ideal, dass zur Zeit ganz offensichtlich zunehmend von autokratischen Parteien, Politiker: und Fürsprecher:innen zerstört wird. Ein kleiner Aspekt entgegen des aktuellen Autokratie-Backlashs ist unsere Fähigkeit, empathisch zu sein. Das können wir täglich beobachten: Wenn wir abends mit der Familie zusammen sind, oder in einem Teammeeting oder in einer Nachbarschaftsgruppe und dann merken: Demokratie passiert auch und gerade außerhalb professioneller Politik. Besonders dann, wenn es uns gelingt, die Gefühle, Gedanken und Perspektiven anderer Menschen zu erkennen, zu verstehen und mitzuempfinden. Insbesondere über Grenzen hinweg.
Denn überall, wo Unterschiede aufeinander treffen, wird ausgehandelt, was in einer Demokratie wirklich zählt: Grenzen, Zugehörigkeit, Würde und Verantwortung. Und die Fähigkeit, Konflikte auszutragen, ohne den anderen als Menschen zu verlieren oder gar gezielt anzugreifen. Empathie fällt uns dabei oft am schnellsten ein. Allerdings verstehen wir den umgangssprachlichen Begriff und das damit verbundene, wissenschaftlich aufgeklärte Konzept nur bedingt präzise. Viele von uns verwechseln sie mit weichgespülter Harmonie-Romantik, Nettigkeit oder gar Zustimmung. Deshalb komme ich gleich zu Beginn zu meiner kontrastierenden These:
Empathie ist nicht (bloß) nett, sondern politisch und demokratisch relevant.
Denn sie ist eine der zentralen, individual- und sozialpsychologischen Grundlage demokratischen Miteinanders. Gerade weil sie so leicht kippen und ins Gegenteil führen kann. Bevor wir tiefer einsteigen, steht erst mal wieder eine Begriffsklärung an:
Was Empathie ist – und was nicht
Empathie kommt vom altgriechischen empátheia, der leidenschaftlichen Einfühlung. Der Begriff setzt sich aus em- „in, hinein“ und pathos „Gemütsbewegung, Leidenschaft“ zusammen. Über das Englische empathy wurde es als Lehnübersetzung des deutschen Begriffs „Einfühlung“ wieder ins Deutsche übernommen, um einen Fachbegriff zu schaffen, der die Fähigkeit beschreibt, sich in andere hineinzuversetzen und deren Innenleben nicht nur rational zu erfassen sondern mitfühlend zu begreifen. Soweit die Wortherkunft in aller Kürze.
Über dieses etymologische Verständnis hinaus gibt es bis heute keine einheitliche, verbindliche wissenschaftliche Definition von Empathie, aber es zeichnet sich ein breiter Kernkonsens über zentrale Elemente ab. Ein „Review of reviews“ zeigt, dass Empathie in den meisten Disziplinen als Prozess verstanden wird, in dem eine Person versteht, fühlt und das Erleben einer anderen Person teilt, bei einer gleichzeitigen klaren Unterscheidung zwischen dem Selbst und der jeweils anderen Person (Håkansson & Summer Meranius 2021). Große konzeptuelle Reviews betonen, dass Empathie multidimensional ist und typischerweise aus kognitiven Komponenten (Perspektivübernahme/Verstehen) und affektiven (Gefühl-/Affektteilung) besteht. Ergänzend sehen neurologisch und entwicklungspsychologische Arbeiten Empathie‑bezogene Fürsorge und Prosozialität als weiteres Element. Gleichzeitig dokumentieren Metaanalysen, dass es „fast so viele Definitionen wie Autoren“ gibt und dass die Verwendung des Begriffs oft unscharf und widersprüchlich ist.
Wichtig sind drei Abgrenzungen, die für unsere Demokratie essenziell sind:
- Empathie ist nicht Zustimmung. Ich kann Dich verstehen, ohne Dir recht zu geben.
- Empathie ist nicht Harmonie. Sie ist eine Beziehungskompetenz. Auch und gerade bei Konflikten.
- Empathie ist nicht Selbstaufgabe. Wer sich selbst verliert, verliert auch den Kontakt und die Verbindung zum Gegenüber.
Warum ist Empathie für Demokratie relevant?
Empathie ist weder banal noch eine Luxuskompetenz. Sie ist ein zentrales soziales Bindemittel für unsere Demokratie, wenn wir sie wie von mir vorgeschlagen kritisch-konstruktiv reflektieren und vor allem über tiefgreifende Unterschiede hinweg kultivieren. Sie ermöglicht dann mindestens vier Dinge, die im demokratischen Alltag ständig gebraucht werden:
Empathie als Würde-Sensor: Sie ist die Fähigkeit, im Gegenüber nicht nur eine Position zu sehen, sondern einen Menschen, der genauso wie wir selbst zutiefst menschliche Bedürfnisse hat. Das ist vor allem in polarisierten Situationen keine naive Idee, sondern eine Schutzfunktion: Wenn sie über Gruppengrenzen hinweg ermöglicht wird, verhindert sie, dass Konflikte in zerstörerische Aggression, Spaltung und manchmal sogar Entmenschlichung kippen. Was uns unmittelbar zum nächsten Punkt bringt:
Empathie als Konfliktfähigkeit: Demokratie lebt nicht davon, dass wir uns einig sind, sondern dass wir uneinig sein können, ohne die Beziehung zu zerstören, oder genauer: Eine universale Verbundenheit und Kontakt. Empathie ist dabei das, was den Kontakt hält, während die Differenz sichtbar bleiben oder sogar noch klarer werden darf. Das ist die zwingende Grundlage für konstruktive Konflikte, die ja neben einem Risiko immer auch eine Chance darstellen, weiter zusammenzuwachsen, sich anschließend mehr zu vertrauen und (neue) Lösungen finden.
Empathie als Gegenkraft zur „Wir gegen die“-Logik: Unser Gehirn reagiert stark auf Gefahr, Status und Gruppenzugehörigkeit (Innen- und Außengruppe). Konflikte erzeugen und binden dabei Aufmerksamkeit. Genau deshalb sind Empörung, Skandalisierung und Polarisierung so anschlussfähig und in den sozialen Medien so extrem wirksam. Empathie ist hier keine sentimentale Zugabe, sondern eine Gegenkompetenz: Sie unterbricht unter der Bedingung der Grenzüberschreitung die automatische Eskalation.
Empathie als prosoziale Motivation: Empathisches Mitgefühl kann Menschen tatsächlich zum Helfen bewegen. Das ist empirisch gut belegt. Eine Meta-Analyse stützt den Zusammenhang zwischen Empathie und prosozialem Verhalten (Eisenberg & Miller 1987). Vier Jahre später zeigte eine Studie, dass empathisch ausgelöste Sorge ein starker Treiber prosozialen Handelns sein kann (Batson et al. 1991).
Für unsere Demokratie bedeutet das: Wenn Empathie gelingt, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass wir Verantwortung füreinander übernehmen. Auch jenseits unseres unmittelbaren Eigennutzes. Die gute Nachricht: Das kann funktionieren.
Die dunkle Seite der Empathie
Genau an diesem Punkt wird es besonders interessant. Denn Empathie ist eben leider keine automatische Friedensmaschine. Das ist mehr als offensichtlich. Sie hat vielmehr eine Schattenseite, die demokratiepolitisch hoch relevant ist.
Erstens: Empathie kann erschöpfen (Empathic distress): Viele von uns kennen das: Wir hören zu, nehmen viel auf, spüren die Emotionen der anderen und fühlen uns danach leer oder auf die eine oder andere Weise ausgelaugt. Oder es kommt zu einer Mitgefühlsmüdigkeit – eine Form des Burnouts – als Beispiel dafür, wie ein Übermaß an Altruismus bei Pflegekräften zu Leiden führen kann und tatsächlich einen Rückgang der Hilfsbereitschaft zur Folge hat (Klimecki & Singer 2012).
Zweitens: Empathie ist parteiisch (Ingroup/Outgroup). Wir fühlen leichter mit Menschen, die uns ähnlich(er) sind und schwerer mit denen, die wir als „anders“ erleben und zu oft auch so markieren. Das betrifft alle möglichen Unterschiede wie demografische Merkmale: Geschlecht und sexuelle Identität, Alter, Bildung, Ethnie und natürlich die politische Position. Die Forschung spricht in diesem Zusammenhang von intergroup empathic failures: Wenn Gruppenidentitäten stark sind, bricht Empathie unglücklicherweise genau dort ein, wo sie am meisten gebraucht würde (Cikara et al. 2011). Empathie kann aber sogar selbst zwischen minimal unterschiedlichen Gruppen, deren Grenzen willkürlich sind, so fragil sein, dass Kinder, die zufällig Gruppen zugewiesen wurden (z. B. dem „roten” oder dem „blauen Team”), mehr Empathie für Mitglieder ihrer eigenen Gruppe zeigen als für Mitglieder anderer Gruppen, die sozial abgelehnt werden (Masten et al. 2010).
Noch schärfer formuliert: Parochiale Empathie – eine stärkere Empathie für die eigene Gruppe als für Fremdgruppen – geht mit geringerer Hilfsbereitschaft gegenüber Fremdgruppen und mit größerer Zustimmung zu deren Benachteiligung oder passivem Schaden einher. Empathie kann daher intergruppale Beziehungen sowohl verbessern als auch verschlechtern – entscheidend ist, wem sie gilt. (Bruneau et al. 2015). Mit anderen Worten: Empathie kann, wenn wir sie im Kontext von Demokratie betrachten, diese ebenso stärken, wie Spaltung stabilisieren und sogar vertiefen. Entscheidend ist, ob Empathie über Gruppen hinweg wirksam wird oder vor allem nach innen gerichtet bleibt – und ob öffentliche Diskurse, Medien und soziale Kontexte Begegnung und Perspektivwechsel ermöglichen oder eher verhindern.
Drittens: Empathie kann über Grenzen hinweg funktionieren. Klimecki und Kolleg:innen konnten sogar darauf hinweisen, dass Empathie- und Mitgefühlstraining unterschiedliche Effekte haben und zwar mit deutlich stabilisierenderer Wirkung bei Mitgefühl (Klimecki et al. 2014). Das Mitgefühlstraining unterschied sich in einem zentralen Punkt vom Empathietraining: Es zielte darauf, die Empathie, die man normalerweise für nahestehende Menschen empfindet, auf andere auszuweiten, also grenzüberschreitend zu sein. Das führt zu einer begrifflichen Schärfung: Empathie und Mitgefühl sollten nicht als identisch angenommen werden. Gerade das deutsche Wort Mit-Gefühl ist überaus trefflich.
Viertens: Empathie ist manipulierbar, sie kann auch missbraucht werden. Durch moralische Erpressung, Opferkonkurrenz oder performatives Mitfühlen. Und sie kann uns in Einzelfälle hineinziehen, während strukturelle Fragen dadurch unsichtbar bleiben oder sogar gemacht werden. Der Psychologe Paul Bloom hat diese Kritik populär gemacht: Empathie sei anfällig für Verzerrungen, weil sie Nähe, Identifikation und dramatische Einzelschicksale bevorzugt (Bloom 2016). Für demokratische Prozesse ist das eine Warnung: Wir brauchen Mitgefühl und Urteilskraft.
Von Empathie zu demokratischer Resonanz – trotz Unterschiede
Wenn Empathie so ambivalent ist, was folgt dann daraus? Ganz klar: Rohe, unbearbeitete Empathie ist keine demokratische Kompetenz. Es braucht ihre Läuterung, die Entwicklung hin zum grenzüberschreitenden Mit-Fühlen. Das könnten wir demokratische Resonanz nennen. Und tatsächlich gibt es dazu ermutigende Forschungsergebnisse, hier nur drei Beispiele:
- In einer großen Feldstudie steigerte ein Hörspiel in Ruanda, das positive Interaktionen zwischen verschiedenen Gruppen darstellte, die Empathie der Hutus gegenüber den Tutsis (Paluck 2009).
- Eine videobasierte Online-Interaktion zwischen mexikanischen Einwanderern und weißen Amerikanern sowie Israelis und Palästinensern führte bereits nach 20 Minuten zu einer vorübergehenden Zunahme positiver Einstellungen und Empathie gegenüber der Außengruppe (Bruneau & Saxe 2011).
- Im Vergleich zu Kontrollgruppen zeigten singhalesische Teilnehmer aus Sri Lanka, die an einem viertägigen intergruppalen Workshop teilgenommen hatten, auch ein Jahr nach der Teilnahme ein gesteigertes Einfühlungsvermögen gegenüber Tamilen (Malhotra & Liyanage 2005).
Empathie ist dann nicht mehr nur eine auf die eigenen Gruppen beschränkte Kompetenz, sondern eine wichtige demokratische Praxis. Und zwar eine, die durchaus gelingen kann, wie die verschiedenen Experimente nahelegen.
Mini-Experimente für den Alltag
Empathie wird nicht alleine dadurch besser, dass wir über sie nachdenken und reden. Wir entwickeln sie, indem wir sie üben, wie die obigen Beispiel zeigen. Das müssen keine besonders aufwändigen Trainings sein für viel Geld. Schon erste kleine Experimente und Übungen könnten nützlich sein:
1) Hören und Erspüren
Höre im Gespräch genau zu, was Dein Gegenüber sagt (Sacheben) und versuche zu erspüren, was ihr dabei wirklich wichtig ist. Gegebenenfalls kannst Du das auch aussprechen, nur innerlich oder für Dein Gegenüber: „Was ich dich sagen höre, ist … Und dahinter scheint dir wichtig zu sein, dass …“ Das zwingt nicht zur Zustimmung, sondern differenziert im ersten Schritt zwischen der sachlichen und emotionalen Ebene.
2) Klarheit statt Schwächung
Experimentiere in verschiedenen Situationen, in denen es deutliche Unterschiede zwischen Dir und dem oder den anderen gibt, mit dieser Haltung: „Wenn ich Dich deutlich spüre, ernst nehme und nicht entwerte, wird mein Standpunkt nicht schwächer, sondern klarer.“ Das trainiert die Fähigkeit, Unterschiede nicht nur wahrzunehmen und auszuhalten, sondern sie sogar fruchtbar zu machen. Denn Multiperspektivität ist genau das, was wir zur Lösung komplexer, demokratierelevanter Probleme mehr denn je brauchen.
3) Empathie mit Grenze
Wenn du bei einem sehr bewegenden Gespräch oder auch wortlosen Beisammensein merkst, dass du innerlich überflutet wirst: Atme. Ein und aus. Und benenne dann die Grenze, wieder nur innerlich oder auch für Dein Gegenüber: „Ich bin bei Dir, und ich merke gerade: Ich brauche einen Moment, um das zu sortieren.“
Diese Art von Empathie ist nicht bloß mitfühlend, was schon viel mehr ist als bloße Ingroup-Empathie. Sie ist zudem stabiler und ermöglicht fruchtbare Entwicklungen durch eine tiefgreifende Multiperspektivität, ohne die eigene Perspektive zu überhöhen oder zu verleugnen. Und genau deshalb ist sie demokratisch.
Herzliche Grüße
Andreas
Einladung ZOON Connect
Wenn du Lust hast, diese Kompetenz im Kontext von Demokratie neu zu entdecken, dann freue ich mich, auch Dich beim nächsten ZOON Connect am 17. Februar zu treffen.
Wir nähern uns dem Thema wie immer mit Mini-Experimenten, Austausch und Reflexion. Und vielleicht erleben wir eine von mehreren demokratische Hoffnungen: Dass wir Unterschiede nicht auflösen müssen, um verbunden zu sein und zu bleiben. Und dass sie sogar wertvoll sind.
📅 17. Februar 2026, 19:00 – 20:30 Uhr, Online
🎫 Anmeldung und kostenfreies Ticket: https://tinyurl.com/ZOONConnect-Empathie
Literatur
- Batson, C. et al. (1991): Is Empathic Emotion a Source of Altruistic Motivation? Journal of Personality and Social Psychology, 40(2): 290–302
- Bloom, P. (2016). Against Empathy. Ecco.
- Bruneau, E. & Saxe, R. (2011): The Power of Being Heard: The Benefits of ‘Perspective-Giving’ in the Context of Intergroup Conflict. Journal of Experimental Social Psychology, 48(4): 855–866
- Bruneau, E., Cikara, M., & Saxe, R. (2015). Parochial empathy predicts reduced altruism and increased aggression toward outgroups, Social Psychological and Personality Science, 8(8): 934–942
- Cikara, M., Bruneau, E., & Saxe, R. (2017). Us and them: Intergroup failures of empathy. Current Directions in Psychological Science, 20(3): 149–153
- Eisenberg, N., & Miller, P. A. (1987). The relation of empathy to prosocial and related behaviors: A meta-analysis. Psychological Bulletin, 101(1): 91–119
- Håkansson E. & Summer Meranius, M. (2021): Toward a consensus on the nature of empathy: A review of reviews, Patient Education and Counseling, 104(2): 300–307
- Klimecki, O. & Singer, T. (2012): Empathic distress fatigue rather than compassion fatigue? Integrating findings from empathy research in psychology and social neuroscience. In B. Oakley,
- et al. (Eds.), Pathological altruism: 368–383, Oxford University Press
- Klimecki, O. et al (2014): Differential Pattern of Functional Brain Plasticity after Compassion and Empathy Training. Social Cognitive and Affective Neuroscience, 9(6): 873–879
- Singer, T., & Lamm, C. (2009). The social neuroscience of empathy. Annals of the New York Academy of Sciences.
- Malhotra, D. & Liyanage, S. (2005): Long-term effects of peace workshops in protracted conflicts. Journal of Conflict Resolution, 49: 908–924
- Masten, C. et al. (2010): Children’s intergroup empathic processing: The roles of novel ingroup identification, situational distress, and social anxiety. Journal of Experimental Child Psychology, 106: 115–128
- Paluck, E. (2009): Reducing intergroup prejudice and conflict using the media: A field experiment in Rwanda. Journal of Personality and Social Psychology, 96: 574–587
Bildnachweis
Beitragsbild: ©Toa Heftiba, unsplash lizenzfrei
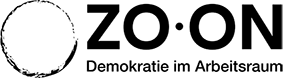

No responses yet