Rassismus und Elitarismus sind in unseren Demokratien und Gesellschaften strukturell verankert. Sie waren von Anfang an ein konstitutives Merkmal unserer politischen Ordnung.
Dies gilt keineswegs nur in der griechischen Ur-Demokratie, sondern auch in ihrer modernen amerikanischen und französischen Variante. Es geht mir um eine historische Einordnung und Herleitung struktureller Probleme unserer modernen Demokratie, deren Wurzeln bis in die Gründungszeit zurückreichen. Dieser belegbare Umstand ist bis heute viel zu wenig Teil unseres öffentlichen Diskurses zur Entwicklung unserer Demokratie.
Die Wiege der Demokratie
Wenn wir nach Griechenland schauen, wird sofort klar: Der Demos, das Staatsvolk und damit die Demokratie waren von Anfang an exklusiv und elitär ausgerichtet. Schließlich gab es damals noch Sklaven, was heute kaum mit unseren zeitgenössischen Ideen von Demokratie vereinbar ist. Wahlberechtigt waren in der attischen Demokratie ab dem fünften Jahrhundert v. Chr. zudem nur männliche Vollbürger Athens ab dem 30. Lebensjahr. Frauen waren genauso ausgeschlossen wie Zugezogene. Diese Exklusion führte dazu, dass damals nur rund 10% der gesamten Bevölkerung wahlberechtigt waren. Alleine das reicht schon, um zu verstehen, dass unserer heutigen Demokratie Ungleichheit tief in ihrer DNA eingeschrieben ist.
Über diese bekannten Umstände hinaus gab es noch weitere konzeptuelle Aspekte, die als rassistisch-nationalistischer Ursprung innerhalb der Demokratie interpretiert werden können: Für Aristoteles bestand die Grundlage der Demokratie in der Freiheit, die wiederum auf drei Säulen steht: Der Autonomia (Selbstgesetzgebung), der Autochthonia (Selbsterdigkeit (einheimisch, eingeboren)) und der Autarkia (Selbstversorgung). Die Autochthonia – das Volk solle eingeboren und nicht gemischt sein – feierte in den 1990ern seine Wiederkehr in Europa ebenso wie in Afrika und erfreut seit dem Rechstpopulist:innen und -extreme (Geschiere 2014). Der israelische Althistoriker Benjamin Isaac bringt seinen Begriff des Proto-Rassismus mit der griechischen Autochthonie in Verbindung, ohne dabei deutliche Unterschiede zu einem modernen biologistischen Rassebegriff einzuebnen.

Die Auflösung der europäischen dreigliedrigen Gesellschaft von Klerus, Adel, Bauern & Bürger unter anderem durch die französische Revolution hat, ähnlich wie die griechische Demokratie, ein ihr innewohnendes Systemproblem. Einige der geistigen Wegbereiter schufen eine fatale Pfadabhängigkeit, die sich bis heute tief in unser Demokratieverständnis gebrannt hat. Der erste Schritt dorthin ist die Vorstellung, eine gelungene Demokratie brauche eine kompetente und verantwortungsvolle Elite. Diese Vorannahme findet sich in der amerikanischen und französischen Demokratie. In Amerika forderte John Adams (Abb. links): “Da eine gute Regierung ein Reich der Gesetze ist, wie sollen eure Gesetze gemacht werden? In einer großen Gesellschaft, die ein ausgedehntes Land bewohnt, ist es unmöglich, dass sich die Gesamtheit versammelt, um Gesetze zu erlassen: Der erste notwendige Schritt ist also, die Macht von den vielen auf einige wenige der Weisesten und Besten zu übertragen (Adams 1776: Online, Übersetzung und kursiv AZ)
Boissy D’Anglas, Vorsitzender des Konvents, verknüpfte in seiner Rede knapp 20 Jahre später am 23.06.1795 vor dem Konvent den Elitegedanken mit Bildung und Eigentum und spezifiziert, wie diese Elite identifiziert werden kann. Was bei Adams noch vage blieb – wer definiert, wie wir die “Weisesten” und “Besten” erkennen und bestimmt anschließend die diesbezügliche Elite? – das führt D’Anglas zumindest grob weiter aus:
“Wir müssen von den Besten regiert werden; die Besten sind diejenigen, die am besten ausgebildet sind und die am meisten an der Aufrechterhaltung der Gesetze interessiert sind; allein von einigen wenigen Ausnahmen abgesehen, findet man solche Menschen unter denen, die Eigentum haben, die dem Land in dem dieser Besitz liegt, oder den Gesetzen, die es schützen … verpflichtet sind … ein Land, das von Eigentümern verwaltet wird, ist innerhalb der sozialen Ordnung; ein Land, über das die Besitzlosen herrschen, befindet sich im Naturzustand” (van Reybrouck 2014: 97, kursiv AZ). Deutlicher geht es nicht.
Und vor allem wo führt das hin? Wäre in der Logik nicht ein simples quantitatives Maß anzulegen? Je mehr Eigentum, desto weiser und besser für die Regierung geeignet. Schließlich müsste ja gelten: Je reicher, desto erfolgreicher weil klüger das eigene Imperium aufgebaut. Wäre Dieter Schwarz (Kaufland, Lidl) mit ca. 50 Milliarden Euro besser als Kanzler geeignet als Stefan Quandt (BMW) mit knapp 25 Milliarden Euro Vermögen? Aber D’Anglas zufolge wären beide auf jeden Fall die bessere Wahl als Friedrich Merz. Hinzu kommt: Cheryl Harris, Professorin für Bürgerrechte und bürgerliche Freiheiten an der UCLA School of Law, zeigt in Whiteness as Property (1993), wie Weißsein selbst zum geschützten Privileg geworden ist. Und zwar analog zu materiellem Eigentum, mit Recht auf Nutzung und Ausschluss: z.B. segregierte Schulen, Wohnungsmarkt-Restriktionen, Gesetze gegen Eheschließung zwischen Menschen verschiedener ethnischer Herkunft. Weißsein wurde also wie ein Rechtsanspruch behandelt, den Gerichte geschützt haben. Das bereichert die Analyse um eine Dimension, in der Rassismus nicht nur kulturell fortwirkt, sondern als juristisches Konzept tief in einer Demokratie verankert ist.
Wahlen als Elitensicherung
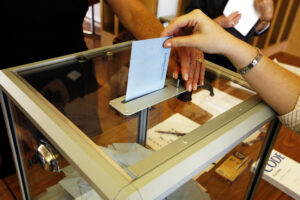 Diese frühe Elitenlogik hat sich in heutigen Wahl- und Repräsentationsmechanismen fortgeschrieben. Es ist kein Zufall, dass die großen, wegweisenden Demokratien in England, Frankreich und den USA jeweils Wahlen als konstitutives Merkmal definiert haben. Seit 1948 wurden sie weltweit als zentrales Merkmal in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen im Artikel 21 definiert: “Der Wille des Volkes bildet die Grundlage für die Autorität der öffentlichen Gewalt; dieser Wille muss durch regelmäßige, unverfälschte, allgemeine und gleiche Wahlen mit geheimer Stimmabgabe oder in einem gleichwertigen freien Wahlverfahren zum Ausdruck kommen.” (kursiv AZ)
Diese frühe Elitenlogik hat sich in heutigen Wahl- und Repräsentationsmechanismen fortgeschrieben. Es ist kein Zufall, dass die großen, wegweisenden Demokratien in England, Frankreich und den USA jeweils Wahlen als konstitutives Merkmal definiert haben. Seit 1948 wurden sie weltweit als zentrales Merkmal in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen im Artikel 21 definiert: “Der Wille des Volkes bildet die Grundlage für die Autorität der öffentlichen Gewalt; dieser Wille muss durch regelmäßige, unverfälschte, allgemeine und gleiche Wahlen mit geheimer Stimmabgabe oder in einem gleichwertigen freien Wahlverfahren zum Ausdruck kommen.” (kursiv AZ)
Wenn wir von den “Weisesten” und “Besten” regiert werden sollen, scheint der Mechanismus des Wählens durchaus schlüssig. Schließlich darf es nicht dem Zufall überlassen werden, wer an die Macht kommt. Was keineswegs eine schräge Idee ist, sondern lange Zeit ein wohlüberlegter Mechanismus erst in der griechischen Demokratie und später in diversen Stadtstaaten war (Venedig, Florenz, Bologna, Aragon, Saragossa, Barcelona und Frankfurt am Main). Was wäre, wenn infolge von demokratischen Losverfahren plötzlich ein Supermarktkassierer mit mittlerer Reife und ohne finanzielle Rücklagen mehr Gestaltungsmacht hätte, als ein Millionär mit einer summa cum laude Promotion von der LMU?
Das Ergebnis dieser methodischen Reduktion auf Wahlen sehen wir bei unseren Regierungsvertreter:innen. In Deutschland haben 81% der Bundestagsabgeordneten einen akademischen Abschluss. In der Bevölkerung hingegen bei 18,5% (DeStatis). Interessant sind die Ergebnisse einer aktuellen Studie der University of Europe zur aktuellen Akademikerquote: CDU/CSU und Bündnis90/Die Grünen liegen mit je fast 91% an der Spitze, während die Linke mit 75% und die AfD mit knapp 61% weit abgeschlagen sind (und vielleicht auch deshalb im nicht-akademischen Milieu teils deutlich erfolgreicher sind, als die typischeren Akademiker-Parteien). Allerdings liegt auch die AfD immer noch deutlich über dem Bevölkerungsschnitt.
All das ist kein Wunder. Denn die Forschung hat auch immer wieder gezeigt, dass die politische Beteiligung mit dem Bildungsgrad zunimmt. Je gebildeter, desto eher und mehr politische Teilhabe. So belegen internationale und nationale Studien, dass zusätzliche Schuljahre und höhere Abschlüsse das politische Interesse und Wissen steigern, den Erwerb von politischem Wissen begünstigt und eine positive Einstellung gegenüber politischen Freiheiten fördert (Le & Nguyen 2021). Quasi-experimentelle Analysen aus mehreren Ländern zeigen, dass Bildung sowohl das Vertrauen in demokratische Institutionen als auch die Unterstützung demokratischer Werte stärkt, während deutsche Befunde zudem nahelegen, dass selbst moderate Reformen der Schulpflicht langfristig zu mehr politischem Interesse führen (Bömmel & Heineck 2023). Für die USA wiederum lassen aktuelle Daten erkennen, dass das absolute Bildungsniveau – und nicht nur der relative Vergleich zu anderen – ein entscheidender Faktor für eine höhere Wahlbeteiligung ist (Kim 2023).
Aber Bildung ist nicht das einzige Elitenproblem. In den USA ist das noch interessantere Elitenmerkmal das Vermögen der Kongressmitglieder und Senatoren: Gut 50% sind Millionäre (Center for Responsive Politics), in der US Bevölkerung lediglich 3-4%. Damit ist das Kriterium “vermögend” mehr als 12 mal öfter im Kongress/Senat vertreten, als in der Bevölkerung, während die Akademikerquote im deutschen Bundestag “nur” gut viermal höher ist als bei den Wählenden. So oder so, in beiden Fällen gibt es ein offensichtliches Ungleichgewicht hinsichtlich Bildung und Vermögen zwischen Regierenden und Wählenden. Unter diesen Bedingungen scheint es mir keineswegs übertrieben, einen gewissen Elitarismus festzustellen. Adams und D’Anglas wären wohl zufrieden mit dem Ergebnis. Ob die jeweiligen Repräsentant:innen des Souveräns allerdings die Besten und Weisesten sind, scheint mir fragwürdig. Dazu lohnt ein Blick auf die Folgen dieser Eliten(aus)wahl.
“Government of the People, by the Elite, for the Rich”
 Wenn wir das wirtschaftliche Wohl in den Blick nehmen würden, wird schnell klar, dass Regierungen gerade nicht das Wohl der meisten Menschen im Blick haben, sondern vor allem das der eigenen Kohorte, wie unter anderem eine Studie vor bereits über 10 Jahren zeigte (Gilens & Page 2014). Vier Jahre später wurde dieses Phänomen für die deutsche Politik untersucht (Elsässer et al. 2018): “Unsere Ergebnisse zeigen einen deutlichen Zusammenhang zwischen politischen Entscheidungen und den Meinungen der Reichen, aber keinen oder sogar einen negativen Zusammenhang für die Armen. Die Ungleichheit der Repräsentation in Deutschland ähnelt somit den Ergebnissen für die USA, trotz der unterschiedlichen institutionellen Rahmenbedingungen.” (a.a.O.: iii)
Wenn wir das wirtschaftliche Wohl in den Blick nehmen würden, wird schnell klar, dass Regierungen gerade nicht das Wohl der meisten Menschen im Blick haben, sondern vor allem das der eigenen Kohorte, wie unter anderem eine Studie vor bereits über 10 Jahren zeigte (Gilens & Page 2014). Vier Jahre später wurde dieses Phänomen für die deutsche Politik untersucht (Elsässer et al. 2018): “Unsere Ergebnisse zeigen einen deutlichen Zusammenhang zwischen politischen Entscheidungen und den Meinungen der Reichen, aber keinen oder sogar einen negativen Zusammenhang für die Armen. Die Ungleichheit der Repräsentation in Deutschland ähnelt somit den Ergebnissen für die USA, trotz der unterschiedlichen institutionellen Rahmenbedingungen.” (a.a.O.: iii)
Eine aktuellere Übersichtsarbeit kommt zu dem Ergebnis: “Mit zunehmender sozialer Distanz zwischen Herrschenden und Beherrschten wird die repräsentative Demokratie immer stärker zugunsten der sozial besser gestellten Gruppen verzerrt.” (Elsässer & Schäfer 2023: 469) Wenig verwunderlich, wie mir scheint. Wieso sollten die deutlich wohlhabenden Politiker:innen am eigenen, wohlig eingerichteten Ast sägen, wenn sie doch an der Quelle der Macht sitzen und die Finanz- und Fiskalpolitik für sich selbst und ihresgleichen optimieren können? Genau das zeigt sich in der aktuellen Ablehnung, eine Vermögens- und Einkommenssteuer für (Über)reiche auch nur zu diskutieren (was, wenig überraschend, von der CDU/CSU als Spitzenreiter in der Akademikerquote kommt). In gewisser Weise scheint mir das menschlich. Allerdings kaum weise.
Wenn wir nun noch in Rechnung stellen, dass Vermögen, insbesondere extrem große Vermögen im Milliardenbereich, vorwiegend unter weißen Menschen verteilt sind und nicht-weiße Mitbürger:innen wesentlich seltener über derartige ökonomische Mittel verfügen; und wenn wir zudem bedenken, dass der Anteil an Politiker:innen mit Migrationshintergrund im Bundestag bei rund 11% liegt, aber in der Gesellschaft bei rund 30%, dann zeigen sich diskriminierende Tendenzen weiterhin, auch trotz der weniger rassistisch geprägten modernen Demokratie im Vergleich zur Autochthonie-Forderung in der früheren griechischen Demokratie. Ohne dies für diesen Beitrag weiter recherchiert zu haben, entsteht schnell der Verdacht, dass durch die Forderung nach “Eigentum” als Kriterium für Weisheit und demokratische Kompetenz zugleich möglichst viele nicht-weiße Menschen von der Regierung ausgeschlossen werden sollten.
Jahrhunderte der dreigliedrigen Gesellschaft und ihrer elitären Herrschaft durch Klerus und Adel scheinen den Geist gegen andere Konzepte erfolgreich imprägniert zu haben. Diese enorme historische Gravitation Jahrhunderte alter Ungleichheitsregime hält die Demokratie bis heute in ihrer elitär-repräsentativen Umlaufbahn – wie einen Planeten, der immer wieder denselben Kurs zieht, ohne den eigenen Horizont zu verlassen. Solange wir diese Wurzeln nicht erkennen und benennen, bleibt unsere Demokratie ein Garten in dieser Umlaufbahn, in dem Rassismus und Elitarismus immer wieder nachwachsen. Wenn wir diese Bahn verlassen wollen, müssen wir demokratische Prozesse radikal öffnen, etwa durch mehr Inklusion mit Hilfe von Losverfahren oder Quoten, partizipativeren Instrumente wie Bürgerräte und Volksentscheide sowie die bewusste Aufwertung nicht-akademischer und nicht-weißer Stimmen.
Herzliche Grüße
Andreas
Fußnoten
[1] Gleichwohl sind auch heute noch in Demokratien sklavenartige Verhältnisse zu finden (Human Rights 2018, Marschelke 2015). Die wesentliche Unterschiede zur Sklaverei Griechenlands oder der Kolonialzeit sind die notwendige Verschleiderung und die teils weniger offensichtliche physische Gewalt. Früher war die offene Sklaverei gesellschaftlich legitimiert, heute muss sie verheimlicht werden. Lohnenswert ist dazu die aktuelle Dokumentation “Moderne Sklavenarbeit: Ausgebeutet und unsichtbar vom Y-Kollektiv in der ARD-Mediathek.
Quellen
- Bömmel, N.; Heineck, G. (2020) Revisiting The Causal Effect of Education on Political Participation and Interest. Working Paper No. 92. LIFBI WORKING PAPERS
- Elsässer, L., Schäfer, A. (2023): Political Inequality in Rich Democracies. Annual Review of Political Science,26 (1): 469–487
- Elsässer, L., Hense, S. und Schäfer, A. (2018): Government of the People, by the Elite, for the Rich: Unequal Responsiveness in an Unlikely Case. Discussion Paper No. 18/5. MPIfG Discussion Paper
- <Geschiere, P. (2024): Autochthonie, Zugehörigkeit und Exklusion: Die widersprüchlichen Verflechtungen des Lokalen und Globalen in Afrika und Europa. Historische Anthropologie 21(1): 85–102
- Gilens, M.; Page, B. (2024): Testing Theories of American Politics: Elites, Interest Groups, and Average Citizens. Perspectives on Politics, 12(3): 564–581
- Harris, C. (1993): Whiteness as Property. Harvard Law Review 106(8): 1707–1791
- Human Rights (2018): Moderne Formen der Sklaverei: Ein Überblick. Blog humanrights.ch
- Isaac, B. (2004): The invention of racism in classical antiquity. Princeton University Press
- Kim, Y. (2023): Absolutely Relative? How Education Shapes Voter Turnout in the United States. Social Indicators Research, 164(2): 745–768
- Le, K.; Nguyen, M. (2021): Education and political engagement. International Journal of Educational Development, 81: 102384.
- Marschelke, J.-C. (2015): Moderne Sklaven. Aus Politik und Zeitgeschichte.
- Piketty, T. (2020): Kapital und Ideologie. C.H. Beck
- van Reybrouck, D. (2014): Gegen Wahlen. Wallstein
Bildnachweis
- Beitragsbild: ©Andreas Zeuch, Prompt für ChatGPT
- John Adams: gemeinfrei
- Wahlurne: ©Rama, CC BY-SA 2.0 fr
- Fiktiver elitärer College-Abschluss: ©Andreas Zeuch, Prompt für ChatGPT
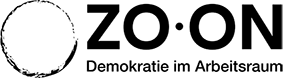

No responses yet