Wer regelmäßig Nachrichten liest, oder in Kurzform auf den elektronischen Devices wahrnimmt, geht leicht in diesen unterschiedlichen Echokammern uninformiert verloren.
Es gibt dazu ein aktuelles Beispiel: Am 17. Juli 2025 veröffentlichte das Online-Portal NIUS, unter Leitung von EX-Bild-Chef Reichelt, eine Behauptung, in dem erneute Zweifel an der Eignung der Bundesverfassungsrichterin Frauke Brosius-Gersdorf gestreut wurden. Diesmal stand ihr Ehemann im Zentrum: Angeblich vertrete er die gegenteilige Haltung zu einem AfD-Verbotsverfahren als sie. Reichelt konstruiert daraus einen impliziten Widerspruch im Ehepaar, der Zweifel an ihrer Unabhängigkeit und Integrität säen soll. Doch für diese Behauptung gibt es keinerlei belastbare Quelle.(Quelle 1)
Hubertus Gersdorf ist ein ausgewiesener Verwaltungsrechtler. Die Vorstellung, er würde öffentlich oder gar publizistisch gegen die Position seiner Frau Stellung beziehen, ist konstruiert und stützt sich auf keine verifizierbare Aussage. Was hier betrieben wird, ist kein Journalismus, sondern Framing. Und genau hier liegt das Problem: Wahrheit wird zur Verhandlungsmasse.
Die Mechanik der Desinformation: Framing, Meinung und Lückenlogik. Die Methode ist nicht neu: Durch gezielte Formulierungen, suggestive Fragen oder das Setzen von Widersprüchen ohne faktische Grundlage wird ein Eindruck erzeugt, der Vertrauen untergraben soll. Dabei wird mit einem rhetorischen Werkzeug gearbeitet, das Politikwissenschaftler:innen als „Framing“(siehe Literatur) bezeichnen: Begriffe und Zusammenhänge werden so gewählt, dass sie bestimmte Assoziationen erzeugen, bevor Fakten überhaupt geprüft sind.
Ergänzt wird dies durch die sogenannte „Lückenlogik“: Was nicht gesagt wird, wird verdächtig. Wer schweigt, muss etwas verbergen. Und: Wenn sich zwei Personen inhaltlich unterscheiden, kann das nur Konflikt oder Unehrlichkeit bedeuten. Diese Logik ist täuschend einfach und wirkt, weil sie mit Emotionen statt Evidenz arbeitet.
Aber das wird man wohl noch sagen dürfen: Der Unterschied zwischen Meinung und Journalismus. In klassischen wie sozialen Medien löst sich zunehmend die Grenze zwischen Meinung und faktenbasiertem Journalismus auf. Kommentierung, Spekulation und Interpretation stehen gleichberechtigt neben Recherche, Dokumentation und Faktenprüfung.
Ein banales, aber instruktives Beispiel: die Papstwahl. Die Kardinäle sind in einem abgeschlossenen Raum, es dringt nichts nach außen. Trotzdem publizieren Medien tagelang Spekulationen über Ränkespiele, geheime Allianzen, mögliche Kandidaten. Nichts davon ist verifizierbar, fast nichts davon trifft je zu. Doch genau diese spekulativen Inhalte dominieren oft die öffentliche Wahrnehmung.
Wenn Medien sich der Logik der sozialen Medien angleichen, geht ihre originäre Rolle verloren. Und hier kommt die Idee der “vierten Gewalt” ins Spiel. Wer Meinung unter der Überschrift einer Nachricht verbreitet, verstößt nicht nur gegen professionelle Standards – er verletzt auch den journalistischen Kodex. Ziffer 2 des Pressekodex verpflichtet zur sorgfältigen Recherche, Ziffer 1 zur Trennung von Meinung und Nachricht. Wenn Redaktionen diesen Anspruch aufgeben, verspielen sie ihre Rolle als vierte Gewalt.
Wir haben sie festgeschrieben, die vierte Gewalt. Doch was kann und soll sie: Medien als demokratische Kontrollinstanz. Der Begriff der “vierten Gewalt” beschreibt die zentrale Rolle, die Medien in einer Demokratie einnehmen: als Kontrollinstanz neben Legislative, Exekutive und Judikative. Ihre Aufgabe ist es, politische Entscheidungen zu hinterfragen, Regierungen und Institutionen zu kontrollieren, öffentliche Meinung zu informieren und fundierte Debatten anzuregen. Den Bürger transparent, neutral und offen zu informieren.
Die Gewaltenteilung in einer Demokratie soll verhindern, dass Macht an einer Stelle konzentriert wird. Medien tragen durch ihre Kontrollfunktion zur Balance dieser Gewalten bei. Ihre Aufgaben im Einzelnen:
- Information: Sie informieren über politische Vorgänge und Entscheidungen.
- Kritik: Sie hinterfragen und analysieren staatliches Handeln.
- Kontrolle: Sie decken Missstände auf und machen Machtmissbrauch sichtbar.
- Meinungsbildung in der Leserschaft: Sie schaffen eine informierte öffentliche Sphäre, in der demokratische Entscheidungen vorbereitet werden können.
Doch diese Rolle ist bedroht: durch wirtschaftliche Abhängigkeiten, politische Einflussnahme, beschleunigten News-Zyklus und die Konkurrenz durch soziale Medien. Die Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) betont die Rolle der Medien als essentielle Träger politischer Bildung und als Bindeglied zwischen Staat und Bürgerschaft. Sie nennt als zentrale Merkmale: Unabhängigkeit, Transparenz, faktische Präzision und klare Trennung von Nachricht und Kommentar.
Sind die Sozialen Medien die 5. Gewalt und Meinungsraum für eine neue Freiheit? Soziale Medien ermöglichen eine nie dagewesene Pluralität von Stimmen. Doch sie funktionieren nach einer anderen Logik: Algorithmen belohnen Engagement, nicht Wahrhaftigkeit. Wahrheit ist nicht nötig, um Reichweite zu erzeugen. Meinungen werden zur Ware, Polarisierung zum Geschäftsmodell.
Dazu kommt: Die Plattformen verfolgen ein ökonomisches Ziel – sie wollen die sogenannte Retention Time, also die Verweildauer der Nutzer:innen, maximieren. Um das zu erreichen, setzen sie Algorithmen ein, die stark emotionalisierende Inhalte bevorzugen und verstärken. Es geht nicht um Fakten oder ehrliche Information, sondern darum, Aufmerksamkeit zu binden und Nutzer:innen möglichst lange auf der Plattform zu halten (siehe Quellen).
Das ist nicht zufällig so, sondern systemisch bedingt: Soziale Medien sind Privateigentum und unterliegen der Logik kapitalistischer Renditeerwartungen. Und diese Logik setzt sich fort: Ein großer Teil der klassischen Presse ist ebenfalls in den Händen Superreicher – man denke nur an Beispiele wie die Washington Post. Die Vorstellung, Presse sei grundsätzlich unabhängig, ist in dieser Realität zumindest kritisch zu hinterfragen.
Hier entstehen Filterblasen, Echokammern und sogenannte “alternative Fakten”. Plattformen wie X (ehemals Twitter), Telegram oder TikTok fungieren für viele Menschen als primäre Informationsquelle – ohne redaktionelle Prüfung, ohne Einordnung, ohne Verantwortung. Doch Meinung ist nicht Wahrheit. Und Debatte braucht ein Mindestmaß an geteilter Realität.
Was wir brauchen: Medienmündigkeit, Faktenchecks, demokratische Resilienz. Die Unterscheidung zwischen Meinung und Fakten ist kein Luxus, sondern Grundlage demokratischer Deliberation. Umso wichtiger ist es, dass Menschen diese Unterschiede verstehen, erkennen und kritisch hinterfragen können: Medienbildung und Faktenkompetenz, Reflexion über die eigene Informationsblase, Formate, die Desinformationsstrategien sichtbar machen.
Genau hier setzt das Demokratiemodul 6 von ZOON e.V. an: „Fact Check – Wer kontrolliert die Information?“ vermittelt erlebnisorientiert, wie Meinungsbildung, Manipulation und Faktenchecks funktionieren. Es macht sichtbar, wie leicht Narrative wirken – und wie wir ihnen vor allem begegnen können.
Wir glauben: Wahrheit und Information brauchen Schutz. Demokratie beginnt mit Aufklärung. Doch was heißt das eigentlich? Der Wahlspruch der Aufklärung, „Sapere aude!“ – Habe den Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen (Kant), zielt nicht nur auf Unterscheidung, sondern auf Mündigkeit: selbstständiges Denken, verantwortliches Urteilen, aktive Teilhabe.
Doch dieser Anspruch ist auch ein Prüfstein. Adorno und Horkheimer konstatierten bereits in der Dialektik der Aufklärung, dass die Aufklärung ihre eigenen Versprechen nicht eingelöst habe. Vielleicht gilt das auch für die Demokratie selbst: Sie bleibt in Teilen ein uneingelöstes Versprechen – solange nicht alle Menschen gleichermaßen Zugang zu Bildung, Information und Teilhabe haben.
Und genau hier wird der Journalismus zentral. Klassische Medien laufen Gefahr, ihr ureigenstes Potenzial zu verspielen, wenn sie sich der Logik der sozialen Medien unterwerfen. Wenn der Kommentar zur zentralen Darreichungsform wird, wo eigentlich Recherche stehen sollte; wenn subjektive Einschätzungen prominenter sind als belegte Fakten, dann erodiert ihre Funktion als vierte Gewalt.
Ich will nicht die Meinungen einzelner Redakteure lesen. Mich interessiert ihr Journalismus. Ihre Meinung gehört nicht auf die Startseite, nicht in den Newsfeed, nicht ins redaktionelle Zentrum der Zeitung. Sie gehört – wenn überhaupt – klar markiert in den Kommentarbereich oder ins private Umfeld. Journalist:innen sind weder kompetentere Politiker:innen noch wissenschaftliche Autoritäten – und noch seltener echte Expert:innen für Spezialthemen.
Im besten Fall entsprechen ihre Texte dem Pressekodex, sind exzellent recherchiert und erkennbar als hochwertige Informationsquelle. Und selbst dann gilt: Auch objektive Berichterstattung ist nie vollständig frei von subjektiven Prägungen. Denn jedes Urteil, jede Auswahl, jede Formulierung ist Teil eines menschlichen Wahrnehmungsprozesses.
Was wir alle erwarten sollten und deutlich einfordern: Klare, nachvollziehbare, sauber recherchierte Information. Das sehe ich auch als echte Chance, Medien wieder wirtschaftlich zu stärken und relevant zu machen.
Herzliche Grüße
Maria
Literatur (Auswahl)
- Bundeszentrale für politische Bildung: “Medien und Demokratie”. bpb.de
- Deutscher Presserat: Pressekodex, www.presserat.de
- Heribert Prantl: Die vierte Gewalt. Macht und Ohnmacht der Medien (2022)
- Stephan Russ-Mohl: Journalismus in der Krise (2017)
- Ruth Wodak: Politik mit der Angst. Zur Wirkung rechtspopulistischer Diskurse (2016)
- Marina Weisband: Wir nennen es Demokratie (2022)
- Kathrin Passig: Wahrheit und Meinung im digitalen Zeitalter (2021)
- Ingrid Brodnig: Einspruch! Fake News und Verschwörungstheorien kontern (2020)
- Shoshana Zuboff: The Age of Surveillance Capitalism (2019)
- Correctiv, Tagesschau-Faktenfinder, Spiegel-Recherchen zu AfD, Medienkritik
- Framing: Elisabeth Wehling: Politisches Framing
- Zur Funktionsweise von Algorithmen und Retention Time in sozialen Medien: „Algorithmen sozialer Netzwerke sind darauf ausgelegt, Aufmerksamkeit zu maximieren – nicht Wahrheit zu garantieren. Inhalte, die starke emotionale Reaktionen hervorrufen, haben signifikant höhere Verweildauer und Interaktionsraten.“
- Der Spiegel: Die systematische Zerstörung der vierten Gewalt:
https://www.spiegel.de/kultur/donald-trump-und-die-us-medien-die-systematische-zerstoerung-der-vierten-gewalt-a-f11741a7-84bc-4a50-86de-9067a0437afd?giftToken=b0858b96-d068-47b7-8cfe-dc9c63c8b4c6
Quellen
Quelle 1 zu Artikel auf Nius
Quelle 2: Vosoughi, Roy; Soroush, Deb; Aral, Sinan (2018): The spread of true and false news online. In: Science 359(6380), S. 1146–1151. DOI: 10.1126/science.aap9559 Diese berühmte MIT-Studie zeigt, dass falsche Nachrichten sich schneller und weiter verbreiten als wahre – vor allem, weil sie emotionaler sind.
Quelle 32: Zuboff, Shoshana (2019): Das Zeitalter des Überwachungskapitalismus. Campus Verlag. Zuboff beschreibt detailliert, wie Plattformen wie Facebook, Instagram und TikTok durch verhaltensbasiertes Targeting und algorithmisches Design Retention Time maximieren, oft auf Kosten von Wahrheit und demokratischer Diskursfähigkeit.
Quelle 4: Centre for Humane Technology. Die Organisation (bekannt aus der Doku The Social Dilemma) zeigt, wie „engagement-based ranking“ zu systemischer Polarisierung führt.
Zur Eigentumsstruktur großer Medienhäuser und dem Einfluss von Superreichen: „Ein guter Teil der Presse ist eben nicht unabhängig – viele große Medienhäuser gehören superreichen Einzelpersonen oder Konzernen, was redaktionelle Unabhängigkeit beeinflussen kann.“
Quelle 5: Wer besitzt die Medien? – Eine globale Analyse (Reporter ohne Grenzen / RSF, 2022): Deutschland: Axel Springer SE gehört zu großen Teilen US-Investoren (KKR), Bertelsmann dominiert mit RTL, Gruner + Jahr, etc.: Medienbesitz in Deutschland, RSF-Bericht (PDF)
Quelle 6: Who owns the Washington Post? Jeff Bezos (Amazon-Gründer) kaufte die Washington Post 2013 für 250 Mio. Dollar.: New York Times Bericht (2013)
Quelle 7: Mazzucato, Mariana (2018): The Value of Everything – Making and Taking in the Global Economy. Penguin: Sie analysiert, wie kapitalistische Strukturen auch den Informations- und Mediensektor durchdringen, inklusive Rendite- und Eigentumslogik.

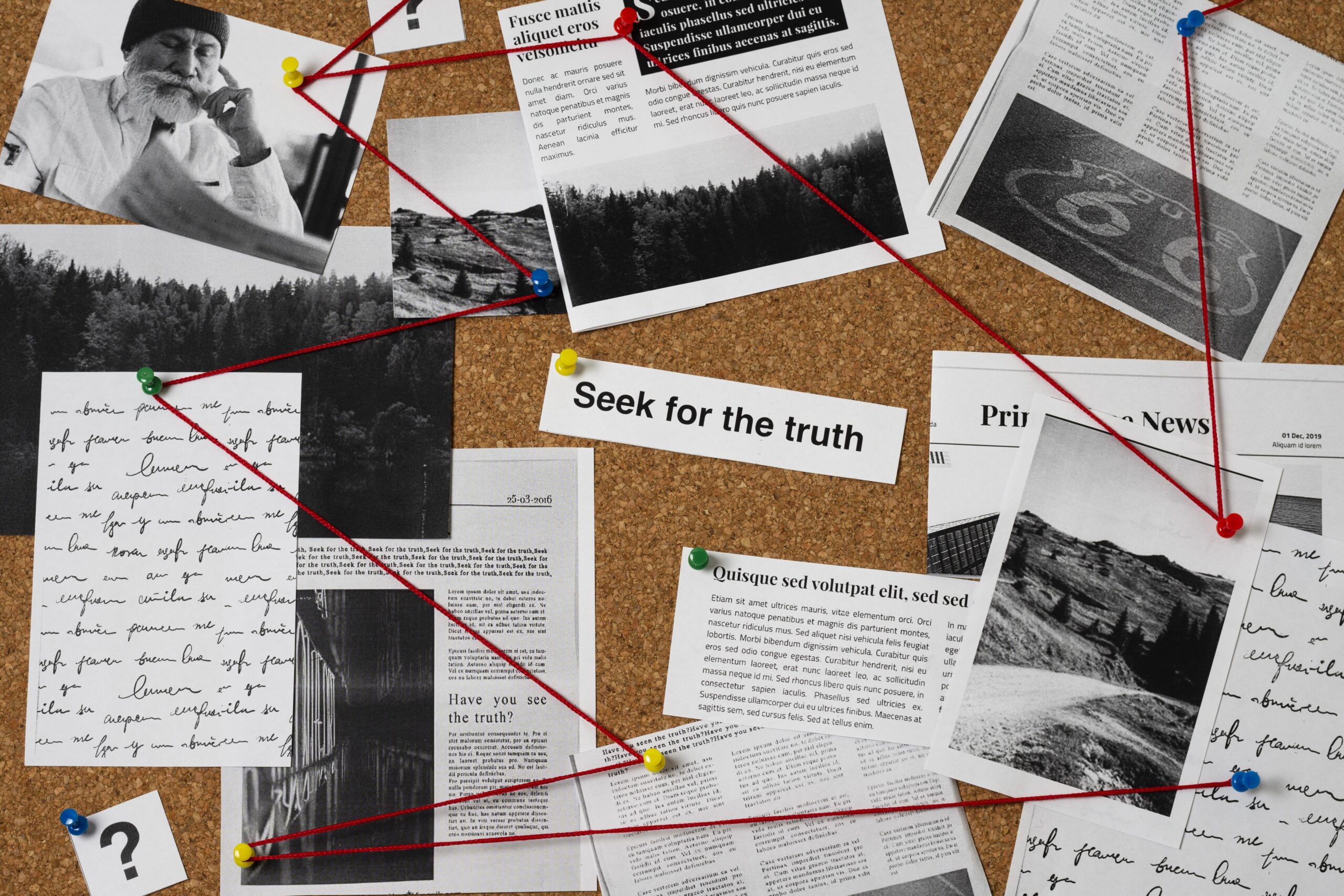
No responses yet